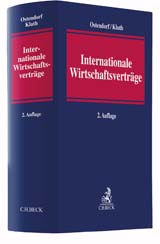Ostendorf / Kluth (Hrsg.), Internationale Wirtschaftsverträge, 2. Auflage, C.H. Beck 2017
Von Carina Wollenweber, Wirtschaftsjuristin, LL.M., Siegen
Bei dem Werk „Internationale Wirtschaftsverträge“ von den Herausgebern Patrick Ostendorf und Peter Kluth handelt es sich um ein Handbuch, welches in der 2. Auflage erscheint. Es beinhaltet 23 Kapitel (§) und 1015 Seiten inkl. Stichwortverzeichnis.
Die ersten 3 Kapitel (§) dienen als Einstieg in die Materie. Zunächst wird in Kapitel (§) 1 grundlegendes Wissen für die Gestaltung von Verträgen im internationalen Bereich vermittelt. Kapitel (§) 2 befasst sich mit dem Vertragsaufbau und der -sprache. In Kapitel (§) 3 wird der rechtliche Rahmen skizziert. Während sich Kapitel (§) 4 mit dem Exportkontrollrecht beschäftigt, widmet sich Kapitel (§) 5 dem Kartellrecht. Die in der Praxis überaus bedeutenden Themen Vertragsstrafe und Schadenspauschalierungen haben ihren Niederschlag in dem 6. Kapitel (§) gefunden. Auch die nachfolgenden Kapitel (§) besitzen eine überragende Bedeutung: Kapitel (§) 7 beschäftigt sich mit Freistellungsklauseln. Die wohl am meisten thematisierten Bereiche „Haftungsbeschränkungs- und Haftungsausschlussklauseln“ werden in Kapitel (§) 8 erläutert. Unter der Überschrift „Vertragliche Regelungen über den zeitlichen Haftungsumfang“ des 9 Kapitels (§) werden Regelungen zur Verjährung behandelt. Kapitel (§) 10 erklärt Force Majeure-Klauseln. Im 11. Kapitel (§) werden die sog. „Boilerplates“ thematisiert: Vollständigkeitsklauseln, Schriftformvereinbarungen und die salvatorische Klausel. Abtretungsverbote sind Gegenstand von Kapitel (§) 12. Besonders relevant in internationalen Verträgen sind Rechtswahlklauseln (Kapitel (§) 13) sowie Streitbeilegungsklauseln (Kapitel (§) 14). Klauseln, welche den Versicherungsschutz einer Partei betreffen, werden in Kapitel (15) behandelt. Kapitel (§) 16 befasst sich mit Klauseln, welche zur Lösung vom Vertrag führen. Kapitel (§) 17 trägt die Überschrift „Vorfeldvereinbarungen (pre-contractual documents)“. Darunter sind zum einen Vertraulichkeitsvereinbarungen und zum anderen Absichtserklärungen zu verstehen. Kapitel (§) 18 trägt die Überschrift „Lieferverträge (sale contracts)“. Dies ist zwar zutreffend; allerdings ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass damit fast ausschließlich das UN-Kaufrecht umfasst sein soll. Kapitel (§) 19 widmet sich den Vertriebsverträgen. Die insbesondere im internationalen Verkehr wichtigen Instrumente zur Zahlungssicherung werden in Kapitel (§) 20 behandelt. Kapitel (§) 21 befasst sich mit Industrieanlagenverträgen. Während Kapitel (§) 22 die Lizenz- und Know-how-Verträge thematisiert, widmet sich das 23. und somit letzte Kapitel (§) den speziellen Open Source Softwarelizenzverträgen. Es lässt sich folglich feststellen, dass das Werk eine große Bandbreite an Themen abdeckt und demnach für die Komplexität der internationalen Wirtschaftsverträge gerüstet ist.
Neben vielen Klauselbeispielen (z.B. S. 24, 28, 121) sind auch Negativbeispiele vorhanden (z.B. S. 30), welche dem Leser zeigen, welche Fehler er vermeiden sollte. Auffällig ist, dass die Musterklauseln in englischer Sprache vorhanden sind. Dies ist im Hinblick auf die internationale Ausrichtung des Werkes positiv zu werten. Allerdings wäre eine deutsche Version der Musterklauseln sehr wünschenswert. Zum einen soll und muss der Leser auch verstehen, was er vereinbart. Zum anderen ist es aber denkbar, dass ein internationaler Vertrag in deutscher Sprache geschlossen wird (z.B. zwischen Unternehmen aus Deutschland und aus der Schweiz oder Österreich). Zudem wird mitunter auch deutsches Recht vereinbart (S. 215), sodass der Leser bspw. erfahren sollte, wie das englische Pendant zu einem deutschen Rechtsbegriff lautet und vice versa. Die Tabellen zum typischen Aufbau eines Vertrages (S. 19) und zu den Bezeichnungen ausgewählter Wirtschaftsverträge (S. 20) werden diesem Erfordernis gerecht. Dadurch wird die Internationalität des Werkes betont.
Der Leser wird explizit auf mögliche Gefahren von Klauselformulierungen und die beste Vorgehensweise hingewiesen (z.B. S. 256 in Bezug auf eine Freistellungsverpflichtung auf erstes Anfordern; S. 358 in Bezug auf Schriftformklauseln). Der Leser muss beachten, dass die Platzhalter in den Klauseln selbst innerhalb einer Klausel nicht immer für dieselbe Partei stehen (z.B. S. 281). Dies hätte besser gelöst werden können, um den Leser nicht durch Unaufmerksamkeit in Gefahr zu bringen. Der Inhalt und die Anwendbarkeit einer Klausel gehen bereits aus der Überschrift hervor. Dies stellt eine Erleichterung für den Leser dar.
Die Praxistauglichkeit des Werkes ergibt sich u.a. auch daraus, dass internationale Online-Datenbanken (S. 11 f.), Literatur und Vertragshandbücher (S. 13) in einer Übersicht dargestellt werden. Somit erhält der Leser übersichtlich komprimiert und strukturiert konkrete Quellen für die weitergehende Recherche.
Besonders hervorzuheben ist der regelmäßige Vergleich zwischen dem deutschen Recht und weiteren Rechtsordnungen wie häufig dem Schweizer, dem englischen oder dem US-amerikanischen Recht (z.B. S. 8 f., 310 ff.). Dabei wird auch immer wieder in angemessen ausführlicher Art und Weise auf die Unterschiede eingegangen. Dies fördert die Praxistauglichkeit sehr. Darüber hinaus ist dem UN-Kaufrecht ein eigenes Kapitel (§ 18) gewidmet. In diesem werden u. a. die Vor- und Nachteile aus Sicht von Verkäufer und Käufer dargestellt (S. 595 ff.). Diese helfen dem Leser, eine fundamentierte Entscheidung darüber zu treffen, ob das UN-Kaufrecht ausgeschlossen werden sollte oder doch eine gute Alternative darstellt.
Der Leser kann sich einen Überblick über das Werk sowohl durch die grobe Inhaltsübersicht als auch durch das Inhaltsverzeichnis verschaffen. Darüber hinaus befindet sich am Anfang jedes Kapitels (§) eine zusätzliche Übersicht mit Verweisen auf die entsprechende Randnummer. Mithilfe der Randnummern kann sehr präzise verwiesen werden. Durch das Sachverzeichnis findet der Leser schnell, was er sucht. Des Weiteren sind sehr umfangreiche Abkürzungs- und Literaturverzeichnisse vorhanden. Zusätzlich befindet sich ein Literaturverzeichnis vor jedem Kapitel (§). Die Bearbeiter werden kurz vorgestellt.
Sprachlich ist das Werk sehr gut zu verstehen. Besonders wichtige Wörter werden durch Fettdruck hervorgehoben. Wie bereits erwähnt wäre eine deutsche Übersetzung der Musterklauseln wünschenswert gewesen, damit der Leser nicht Gefahr läuft, die Klausel falsch zu verstehen.
Fazit: Das vorliegende Werk eignet sich hervorragend für die Praxis und wartet mit einer beinahe überwältigenden Flut an Informationen auf. Insbesondere die große Anzahl an (englischsprachigen) Musterklauseln ist hervorzuheben. Aber auch der immer wieder auftretende Vergleich insbesondere mit dem Schweizer, dem englischen und dem US-amerikanischen Recht darf nicht unerwähnt bleiben. Darüber hinaus wird ebenso das UN-Kaufrecht behandelt. Das Werk bietet nur ein geringes Verbesserungspotenzial, sodass es demnach uneingeschränkt empfohlen werden kann.