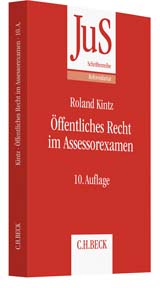Kintz, Öffentliches Recht im Assessorexamen, 9. Auflage, C.H. Beck 2015
Von Rechtsreferendar Dr. Arian Nazari-Khanachayi, LL.M. Eur., Heidelberg
In der Zweiten Juristischen Staatsprüfung – genau wie in der Ersten – gehört das Öffentliche Recht zu den Pflichtfächern. Erfreulicherweise wird das Öffentliche Recht bereits im Studium unter umfangreicher Berücksichtigung des Prozessrechts gelehrt, sodass der Einstieg und der Umgang mit dieser Materie im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdienstes kein umfangreiches Neu-, respektive Umdenken erfordert. Gleichwohl darf dies nicht zu der fahrlässigen Annahme führen, mit dem Wissen aus dem Studium ließen sich alle Besonderheiten der Praxis erfassen. Im Gegenteil: Das universitär erworbene Wissen dient lediglich als äußerst umfangreiche Denkstütze, um das Öffentliche Recht mit Blick auf die Bedürfnisse der Praxis anwenden zu können. Genau an diesem Punkt ist die Neuauflage des Werkes von RiVG Roland Kintz, nebenamtlicher AG-Leiter für Rechtsreferendare und Lehrbeauftragter an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, besonders begrüßenswert, weil es gerade die sich in der Praxis ergebenden Besonderheiten anhand des – zu erwartenden – universitär erworbenen Wissens illustriert. Immerhin betont auch der Verfasser des sich auf dem Stand von Juli 2015 befindenden Werkes, dass das erfolgreiche Gelingen der Zweiten Juristischen Staatsprüfung gerade von der Einübung des materiell-rechtlichen Wissens anhand von „konkreten Beispielen“ abhängt (Vorwort i.V.m. Rn. 1).
In formaler Hinsicht besticht das Werk aus zweierlei besonderen Gründen, die neben den für die JuS-Schriftenreihe leserfreundlichen Hervorhebungskästchen, umfassenden Fußnotenapparat und Intraverweise treten. Die erste hervorzuhebende Besonderheit in formaler Hinsicht sind die unzähligen Formulierungsbeispiele, die dem Leser hilfreiche Textbausteine im Hinblick auf die praxisorientierte /-gerechte (!) Präsentation von „Standardsituationen“ erleichtern: Beispielsweise die Formulierung des Obersatzes/der Anspruchsgrundlage eines öffentlich-rechtlichen Abwehranspruchs (hierzu Rn. 123 a. E.; daneben Rn. 297 a.E.). Flankiert werden solche Formulierungsbeispiele mit exemplarischen Entwürfen ganzer Beschlüsse (siehe Rn. 553 zum Verweisungsbeschluss). Gerichtsspezifische Unterschiede im Hinblick auf die Formulierung bleiben hierbei freilich nicht unbeachtet (vgl. bspw. Rn. 412 in Fn. 15), sodass der Leser im Rahmen des Eigenstudiums anhand von Urteilen für sprachliche Feinheiten sensibilisiert wird.
Zweitens ist die stark klausurorientierte Herangehensweise des Verfassers besonders hervorzuheben, die damit abgerundet wird, dass das Werk mit einer Sammlung von Aufbauschemata abschließt. Das Besondere in diesem Zusammenhang sind die an entsprechenden Prüfungspunkten angebrachten Querverweise auf die (abstrakten) Ausführungen innerhalb des Werkes, wodurch der Leser in die Lage versetzt wird, bei Unsicherheiten im Hinblick auf die richtigen Anknüpfungspunkte und das Auszuführende ohne Aufwand die jeweils einschlägigen Stellen im Werk (nochmals) befragen zu können.
Der besonders erfreuliche, da klausur- und praxisorientierter, Duktus des Verfassers bewahrt das Ziel der Assessorprüfung stets im Auge (scil. „mittels Gesetzesinterpretation und korrekter Subsumtion die in der Aufsichtsarbeit aufgeworfenen Rechtsfragen einer vertretbaren Lösung zuzuführen.“ [so ausdrücklich Rn. 5]) und hebt das Werk in inhaltlicher Hinsicht besonders hervor. So wird bereits zu Beginn des Werkes darauf hingewiesen, dass das (Heraus-)Sortieren und Analysieren der Fakten aus der Prüfungsaufgabe bereits eine zu bewertende Leistung des Referendars darstellt (Rn. 3). Auch andere Hinweise auf die bei der Bewertung von Prüfungsarbeiten zu beachtenden Kriterien werden aufgeführt (vgl. etwa Rn. 116). Spiegelbildlich hierzu liefert Kintzäußerst weiterführende Hinweise bezüglich der korrekten Lesart von Bearbeitungshinweisen (z.B. Rn. 135 oder Rn. 397 mit Fn. 2). In diese Richtung geht der Ansatz des Verfassers des Weiteren, wenn er gerade mit Blick auf seine Erfahrungen als AG-Leiter und Lehrbeauftragter im Hinblick auf die Ausbildung immer wieder auf beliebte Konstellationen in Klausuren hinweist (Rn. 402; Rn. 125). Diese Hinweise werden dadurch abgerundet, dass beispielsweise „klausurrelevante Anfechtungssituationen“ (mit europarechtlichem Einschlag) präsentiert werden, die jeweils mit Verweis auf einschlägige Klausurbearbeitungen aus der Ausbildungsliteratur versehen sind (Rn. 319 mit Fn. 629–632). Diese Zusatzinformationen – neben der reinen Darstellung der Materie – ermöglichen dem (aufmerksamen) Leser, vermeidbare Fehler – sofern vorhanden – auszumerzen und zudem ohne größeren Aufwand (Plus-)Punkte zu sammeln.
Der zuvor beschriebene Duktus lässt sich ferner im Bereich der Tenorierung von Urteilen erkennen, wenn Kintz ausgehend von zahlreichen Beispielen die unterschiedlichen – gesetzlichen – Nuancen aufzeigt (Beispiele finden sich etwa in Rn. 42 i.V.m. Rn. 389 oder in Rn. 33 mit Fn. 41 mit einem baden-württembergischen Landesspezifikum). An dieser Stelle sei zudem erwähnt, dass länderspezifische Unterschiede an den entsprechenden Stellen der Darstellung kenntlich gemacht werden, sodass die Leserschaft aus der gesamten Bundesrepublik bedient wird (Vgl. etwa Rn. 15 f. zu den Ländern, die von § 61 Nr. 3 VwGO Gebrauch gemacht haben; für weitere Beispiele etwa Rn. 8 mit Fn. 3–7, Rn. 31 mit Fn. 38 oder Rn. 407).
Die von Kintzangestrebte praxisorientierte Klausurnähe lässt sich dabei nicht nur anhand der vorstehenden Zusatzinformationen aufzeigen, sondern erfreulicherweise auch gerade anhand seiner Darstellungsweise ablesen: So wird beispielsweise die Begründetheit der Anfechtungsklage mit Blick auf die sog. Einheitsklage (scil. „Verwaltungsakt in der Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid erfahren hat“ [Rn. 305]) als Gegenstand einer solchen Klageart präsentiert. Vor diesem Hintergrund kann der Verfasser sodann verschiedene Konstellationen einer Begründetheitsprüfung und die jeweils dazugehörigen Einstiegssituationen (i.e. Einleitungssätze) in Klausuren illustrieren (näher hierzu Rn. 309 f.). In diesem Zusammenhang ist ein weiteres, das Werk auszeichnendes und daher hervorzuhebendes Kriterium, dass Kintz stets die – soweit vorhanden – praktischen Auswirkungen von unterschiedlichen Ansichten unmittelbar im Anschluss an die Darstellung der jeweiligen Ansichten aufzeigt: Insbesondere lässt sich der Mehrwert dieser Herangehensweise an solchen Stellen aufzeigen, an denen Auswirkungen auf den Tenor, folglich auf den Einstieg in die Klausurlösung festzustellen sind (vgl. etwa Rn. 424). Darüber hinaus ist es besonders hilfreich, dass eine Vielzahl aktueller Urteile an den einschlägigen Stellen des Werkes eingearbeitet sind, die dem aufmerksamen Leser ein Gespür für die aktuell diskutierten Themengebiete zu vermitteln vermögen (vgl. Rn. 188 Fn. 313; Rn. 317 Fn. 627; Rn. 402 Fn. 27; Rn. 555 Fn. 17). Aber auch aktuelle Literaturstimmen werden berücksichtigt (vgl. etwa Rn. 557 mit Fn. 20).
Erfreulich ist schließlich die des Öfteren vorzufindende Berücksichtigung des Europarechts: Das Europarecht wird nämlich von den meisten Prüfungsordnungen als Pflichtfach aufgeführt. Dabei spielt es gerade auch im Verwaltungsrecht eine immer größere Rolle, die nicht zuletzt durch die Festlegung des weiten Anwendungsbereichs der Charta der Grundrechte der EU im Wege einer großzügigen Auslegung des Art. 51 Abs. 1 Var. 2 GRC durch den EuGH in seinem Akerberg Fransson Urteil vergrößert wurde (EuGH Urt. v. 26.02.2013 – C-617/10, insb. Rn. 19). Aus diesem Grunde sind die Ausführungen an einschlägigen Stellen des Werkes besonders erfreulich (vgl. beispielsweise Rn. 313 oder Rn. 557 f.).
Insgesamt ist die Neuauflage des Werkes von Kintz daher jedem Rechtsreferendar, aber auch dem Berufseinsteiger mit dem Schwerpunkt im Öffentlichen Recht dringend zur Lektüre zu empfehlen: Denn nicht nur die unzähligen Hinweise im Hinblick auf eine praxisgerechte Arbeitsmethodik vermögen dem Leser das Umdenken von der reinen Theorie in die Realität der Rechtsanwendung zu erleichtet. Vielmehr ist die Einarbeitung der aktuellen Rechtsentwicklungen, insbesondere in der Rechtsprechung, äußerst hilfreich, um sich etwaige Auswirkungen von punktuellen Entwicklungen im Gesamtsystem effizient zu vergegenwärtigen.